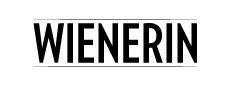Cool, cooler Campino
Am 17. Juni sind die Toten Hosen beim brandneuen Lido Sounds Open Air in Linz zu sehen. Aus diesem Anlass haben wir Frontman Campino (60) zum Interview gebeten und erfahren, dass er seit seiner Kindheit auf Österreich, Wiener Schnitzel und Manner Schnitten steht, warum Fußball für den eingefleischten Liverpool-Fan Kontrollverlust bedeutet und dass der „grumpy old man“ keine Option für ihn ist.
© Bastian Bochinski
An Tagen wie diesen macht die Arbeit noch mehr Spaß“, lautete der Tenor von meiner Kollegin Nicole Madlmayr und mir, nachdem wir Campino via Teams interviewt haben. Und was sollen wir Ihnen sagen: Er kommt cool, sympathisch und absolut bodenständig rüber. Anbei ein paar Facts zum Frontman der Toten Hosen, jener Band, der wir seit 40 Jahren die Treue halten.
Campino, was verbindest du mit Österreich?
Tatsächlich hat mich die Zeit, die ich in Österreich verbracht habe, sehr geprägt. Es waren die schönsten Ferien mit meinem Vater im Skiurlaub. Ich habe das Skifahren auf der Gerlitzen in Kärnten gelernt. Da war ich vier oder fünf Jahre alt. Wir sind mit einer Gondel hoch in die Bergwelt, als es dort noch keine Autos gab. Die Straßen wurden erst viele Jahre später gebaut. Insofern war das für mich schon so etwas wie das Betreten einer Märchenwelt. Ein Ort der Sehnsucht – und das zog sich weiter. In meinem ganzen Leben ist Österreich immer eine geliebte Anlaufstelle gewesen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich Wien als ganz tolle Stadt mit vielen Facetten entdeckt. Und sie ist für mich bis heute faszinierend geblieben. Mein erstes definitives Lieblingsessen in meinem Leben war natürlich das Wiener Schnitzel. Und ich erinnere mich an die Manner Schnitten, die damals noch ein Geheimnis waren.
In Wien hattet ihr als Band in jungen Jahren auch mal eine besondere Begegnung mit Falco …
Ja, damals haben wir im selben Film mitgewirkt wie er. „Der Formel Eins Film“ hieß die Komödie, die man sich heutzutage nicht mehr ansehen muss (schmunzelt). Während der Dreh-
arbeiten hatten wir viel Spaß, irgendwann ist Falco dabei aufgetaucht und wir waren zwei Tage gemeinsam am Set. Wir waren erst mal ein bisschen verwundert, weil er mit Champagner und allen möglichen Delikatessen versorgt worden ist. Wir waren mehr als sechs Wochen bei dieser Filmproduktion dabei und versuchten, unkompliziert zu sein. Dann haben wir bemerkt, dass das die falsche Behandlung der Filmcrew war (lacht). Falco ist mit Dingen verwöhnt worden, die wir bis dahin nicht zu sehen bekommen haben. Also haben wir umdisponiert, uns in Falcos Garderobe gesetzt und dort seinen Champagner getrunken. Was er auch mit Respekt zur Kenntnis genommen hat. Jedenfalls hat er nicht versucht, uns rauszuschmeißen, stattdessen haben wir gemeinsam gefeiert – und alles war gut.
Deine Mutter war Britin, dein Vater Deutscher. Wie fühlst du dich im Herzen? Mehr als Engländer oder Deutscher?
Ich glaube, das kommt immer auf die jeweilige Situation an. Das verschwimmt ineinander. Früher war das klarer zu beschreiben, weil sich die Länder, als ich ein Kind war, noch stark unterschieden haben. Alleine, wenn ich an das Frühstück denke … Aber die Länder haben immer mehr zueinander gefunden, man ist heute mehr auf der Suche nach Gemeinsamkeiten als nach Dingen, die uns unterscheiden. Am besten und wohlsten fühlte ich mich mit der Bezeichnung, dass ich Europäer bin und dass wir etwas gemeinsam hatten – bis zum Brexit! Ich denke, dass ich eine ganze Menge Sorgen, die die Menschen in England haben, weil sie dort wohnen, nicht wirklich verinnerlichen kann, weil ich ja immer in Deutschland gelebt habe. Ich laufe sehr wahrscheinlich Gefahr, Großbritannien von hier aus ein bisschen zu idealisieren.
Kannst du dir dennoch vorstellen, später mal in Großbritannien zu leben?
Diese Vorstellung hatte ich in meinem Leben immer. Ich habe dort auch ein kleines Haus und nach wie vor Verwandte. Ich bin diesem Land sehr verbunden und verbringe dort auch sehr viel meiner Zeit. So gesehen ist es völlig realistisch, mal sechs oder sieben Monate am Stück in England zu sein, sobald die Band weniger aktiv ist.

Die Toten Hosen haben voriges Jahr ihr 40-Jahr-Bandjubiläum gefeiert. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Wie schafft man es, so lange so erfolgreich zu sein?
Ich habe mich nie gefragt, was unser Erfolgsrezept ist. Ich verfolge eher die Philosophie: Solange etwas klappt, hinterfragt man es nicht und fummelt auch nicht daran herum. So ging das ganz gut. Ich habe diese 40 Jahre nie als Arbeit empfunden. Es war für mich immer toll, mit den anderen zusammen die Welt kennenzulernen. Loszufahren, Abenteuer zu bestehen, andere Menschen zu treffen, Freundschaften zu schließen – das war der Sprit, der uns immer am Laufen gehalten hat. Dieses gemeinsame Entdecken der Welt, das war wichtiger als alle möglichen Chart-Entrees oder Verkaufszahlen. Die haben wir natürlich auch gerne mitgenommen, aber essenziell und als Abdruck auf unserer Seele werden die vielen Reisen bleiben, die wir miteinander gemacht haben.
Hättet ihr vor 40 Jahren gedacht, dass ihr so lange als Band zusammenbleiben würdet?
Das hätten wir uns so sicherlich nicht ausgerechnet – und ich weiß gar nicht, ob der eine oder andere da nicht weggelaufen wäre (lacht). Vielleicht war es ganz gut, dass wir keine Ahnung hatten, wie lange es gehen würde.
Wann war der Zeitpunkt, an dem du dir gedacht hast, „Jetzt haben wir es geschafft“? Gibt es so einen Moment überhaupt?
Eigentlich kam die ganze Sache schrittweise. Und jeder, der in Eigenverantwortung ist, also nicht Arbeitnehmer, sondern selbstständig, der weiß, dass man selbst selten das Gefühl hat, nachlassen zu können. Wir waren nie an einem Punkt, an dem wir gedacht haben: So, jetzt können wir uns auf unserem Erfolg ausruhen und es uns gemütlich machen. Wir waren immer von uns selbst angetrieben. Unser Anspruch war immer, uns selbst noch zu toppen und in irgendeiner Form noch besser zu werden. Dass wir davon leben würden, ist mir irgendwann Ende der 80er-Jahre bewusst geworden. Die ersten zehn Jahre haben wir quasi fast nur eingezahlt. Da dachte ich, in die Gruppenkasse zahlt man nur ein, und nicht, dass man da auch was rausholen kann. Eines Tages haben wir auch mal eine Überweisung bekommen und nichts davon zurückgeben müssen. Anfang der 90er-Jahre war es dann realistisch, dass wir uns damit über Wasser halten könnten.
Gibt es ein Lied, das du immer noch am meisten liebst?
Bei ungefähr 400 geschriebenen Songs ist es Gott sei Dank ganz gut, wenn man vielleicht ein, zwei Lieder mehr hat, die man für geglückt hält (lacht). Das mit den Lieblingsliedern wechselt immer, aber es gibt schon eine Reihe von Songs, von denen ich glaube, dass wir es wirklich gut getroffen haben. Eigentlich ist es fast Schicksal, uns laufen die Lieder quasi zu. Wir sind ja nicht dafür verantwortlich, weil wir gar nicht wissen, wie man einen Hit schreibt. Wir stellen nachher fest: Huch, das war ein Hit! Aber wir arbeiten nicht darauf hin, wir können das gar nicht. Wir können dankbar sein, wenn uns Ideen einfallen oder uns ein Liedtext gegeben ist – wie auch immer das zustande gekommen ist. Da gab es dann einige – von „Tage wie diese“ bis hin zu „Hier kommt Alex“, „Alles aus Liebe“ und „Wünsch dir was“ – das sind alles Lieder, die wir bis zum heutigen Tag mögen, und wir lieben es immer noch, sie zu spielen.
Für Musiker heutzutage ist das Streaming wenig lukrativ, besonders wenn sie erst am Anfang stehen. Glaubst du, dass es junge Bands jetzt schwieriger haben als ihr damals?
Die Dinge ändern sich und wir können sie eh nicht stoppen. Die Entwicklung der Streamingdienste ist nicht zu ändern und sie wird noch weitergehen. Natürlich hat sich auch das Hörverhalten geändert. Die Menschen entscheiden innerhalb von Sekunden, ob sie ein Stück anhören wollen oder nicht. Es geht vielleicht auch mehr um einzelne Tracks und weniger um Alben. Vielleicht ist man auch nicht mehr so fanatisch hinter einer speziellen Band her, sondern entscheidet sich für einzelne Musikstücke. Ich glaube, dass die Welt heute mehr Musik denn je hört, aber wahlloser und auch ein bisschen weniger euphorisch als das mal der Fall war. Ich kann das natürlich nicht zahlenmäßig belegen, aber das ist so ein bisschen mein Gefühl. Mir persönlich haben die Zeiten des Vinyl-Albums sehr großen Spaß gemacht. Ich fand es aufregend, wochenlang auf das neue Album einer Band zu warten. Dann kam der Tag X und man hielt diese Schallplatte in der Hand und war glücklich. Heute geht man gelangweilt an den Computer und drückt drauf, sobald es erscheint. Da findet kein Prozess der Sehnsucht mehr statt. Aber der Vorteil ist, dass man alles weltweit sofort zur Verfügung hat. Und wenn man irgendwo in der Wüste steht und man Lust auf irgendeine Rarität hat, muss man einfach nur sein Smartphone in die Hand nehmen und kann das Lied anklicken. Was die jungen Bands angeht: Sie werden ihre Wege suchen und finden, wie sie mit den heutigen Methoden klarkommen. Nachteil ist vielleicht die allgemeine Informationsflut. Vorteil könnte sein, dass man mit den offiziellen Medien weniger zusammenarbeiten muss und sich eigene Kanäle aufbauen kann. Man kann theoretisch auch eigene Vertriebswege einschlagen, wenn man die Kraft dazu hat. Dann muss man weniger Kompromisse mit den Plattenfirmen machen. Es ist also ein ständiges Für und Wider. Ich glaube, dass man generell nicht sagen kann, dass es heute einfacher oder schwieriger ist, sich als Musiker über Wasser zu halten.

Du hast einmal gesagt, Liverpool sei wie ein Date mit deiner großen Liebe und du liebst beim Fußball den Kontrollverlust. Wie darf man das verstehen?
Erstens kann ich es ja nicht steuern, sondern muss akzeptieren, was die Spieler auf dem Platz bringen. Zweitens entsteht dieser Kontrollverlust auch in einem euphorischen Moment, wenn ein ganzes Stadion durchdreht. Das sind alles so Höhepunkte, die in einer Sekunde entschieden werden und alle Zuschauer kollektiv erfahren. 80.000 Menschen stehen im Stadion und sehen im selben Moment, wie ein Ball über die Torlinie geht. Dadurch kommt es zu einer Reaktion, einer Explosion, die mit nicht vielen anderen Dingen zu vergleichen ist. Das ist leidenschaftlich, aber trotzdem völlig harmlos. Es passiert ja nichts, was anderen Menschen schaden könnte. Deshalb ist das eine sehr schöne Art und Weise, etwas sehr, sehr intensiv zu spüren.
Und wie ist es umgekehrt? Wenn ihr auf der Bühne steht und diese Atmosphäre, die ja auch bei Konzerten entsteht, erlebt?
Die Sache mit den Toren ist der große Unterschied (lacht). Natürlich ist im Idealfall auch bei einem Konzert eine Top-Stimmung und auch hier hat man etwas Unvergleichbares. Wenn es ein schönes, emotionales Lied ist, und wir gemeinsam einen Refrain oder eine Textzeile singen können, dann geht es auch jedem in diesem Moment sehr nah. Das ist ein ganz toller Moment und darum bin ich froh, dass ich Musiker geworden bin. Aber die Emotion und Explosion eines Torschusses in einem wichtigen Spiel kann man auf der Bühne nicht erreichen. Dafür können wir aber auch nicht so tief fallen. Wir gehen seltener als Verlierer nach Hause als eine Fußballmannschaft. Das ist auch was Schönes (schmunzelt).
Du hast im Vorjahr deinen 60. Geburtstag gefeiert. Wie empfindest du das Älterwerden? Ist es Belastung oder Privileg?
Zuallererst sehe ich es als etwas Unausweichliches, wenn man vorher nicht unter die Räder kommt. Ich bin mittlerweile in einer Phase, wo ich froh bin, dass ich es so weit geschafft habe. Die Enttäuschung über die hohe Alterszahl ist geringer als die Freude, noch da zu sein – bei all dem, was man schon durchgemacht hat. Es gibt wenig Dinge, über die es sinnloser ist sich aufzuregen. Man nimmt es mit, und letztendlich ist es im Leben so, dass wir immer wieder neue Räume beschreiten. Wir sind alle nur einmal Teenager, Mitte 20 und auch nur einmal 60. Und dann geht es schon wieder in den nächsten Raum, und es liegt an uns, etwas daraus zu machen, das Angebot zu sehen und nicht enttäuscht darüber zu sein, was nicht mehr da ist. Solange wir unser eigenes Alter anerkennen und akzeptieren, kann es uns nichts anhaben.
Der „grumpy old man“ ist also keine Option?
Weniger, vielleicht für mich zu Hause, aber wer will sowas schon sehen? Ein alter Mensch, der fröhlich ist – das ist doch eine feine Sache (lacht).
Gibt es musikalisch oder künstlerisch etwas, was du unbedingt noch machen möchtest?
Ich fahre meine Antennen aus und versuche, wach zu sein und all die Optionen, die auf meinem Weg liegen, wahrzunehmen. Es hat mir zum Beispiel wahnsinnigen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben (Anm. d. Red.: „Hope Street – Wie ich einmal englischer Meister wurde“). Es war toll, im Theater zu spielen und dann noch mit so einem großartigen Schauspieler und Regisseur wie Klaus Maria Brandauer zu arbeiten. Das war für mich eine tolle Zeit! Gleichzeitig ist es auch immer wieder ein großes Glück, mit der Band eine neue Reise zu beginnen. Da bin ich nach wie vor voller Freude, dass wir noch ein paar Abenteuer erleben werden und da gibt es keine Strichliste, die ich abzuhaken hätte.
In deinem Buch gibst du sehr persönliche und berührende Einblicke in dein Leben und auch in deine Familie. Wie schwer ist dir das gefallen?
Ich habe zunächst mal frei von der Leber weg geschrieben, und als das Buch zum großen Teil fertig war, habe ich es meinen Geschwistern und meinem Umfeld zum Lesen gegeben. Ich habe alle, die darin vorkommen, gefragt, ob sie ein Problem damit haben, ob es zu weit geht oder sie das Gefühl haben, ich würde die Familie verraten. Jeder hat es abgesegnet und gemeint, dass ich den Ton gut treffen würde. Niemand fühlte sich dadurch bedroht oder beleidigt. Von daher war es kein Problem, es auch so zu veröffentlichen.
Was wünschst du dir für die Toten Hosen für die Zukunft?
Dass wir alle gesund bleiben und unser bestes Lied noch nicht geschrieben haben. Dass wir die Tage, die noch verbleiben, möglichst sinnvoll verbringen – mit viel Lachen und Lebensfreude.
Und was wünschst du dir für dich persönlich?
Es hört sich immer so banal an, aber ich wünsche mir, dass wir diesen Sommer auf der Tour Spaß haben und den Menschen liefern, was sie sich von uns erwarten. Dass wir noch ein paar Abenteuer erleben und dass mein Umfeld gesund bleibt, mehr braucht es nicht!
Zur Person

Campino heißt mit bürgerlichem Namen Andreas Frege, wurde 1962 in Düsseldorf geboren und ist Frontman der Punkrockband „Die Toten Hosen“, die im Vorjahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat. Als fünftes von sechs Kindern wuchs Campino in Düsseldorf auf. Sein Vater, ein Deutscher, war Richter, seine Mutter eine gebürtige Engländerin. 2019 nahm Campino die britische Staatsbürgerschaft an und ist seither Doppelstaater. Seit seiner Kindheit ist der 60-Jährige glühender Fan des Liverpool FC und ein guter Freund von Trainer Jürgen Klopp. Campino arbeitet auch als Schauspieler und stand 2006, in der von Klaus Maria Brandauer inszenierten „Dreigroschenoper“, auf der Bühne. Bekannt sind Campino und die „Hosen“ auch für ihr soziales Engagement, zuletzt spielten sie ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Campino hat einen erwachsenen Sohn und ist seit 2019 verheiratet.